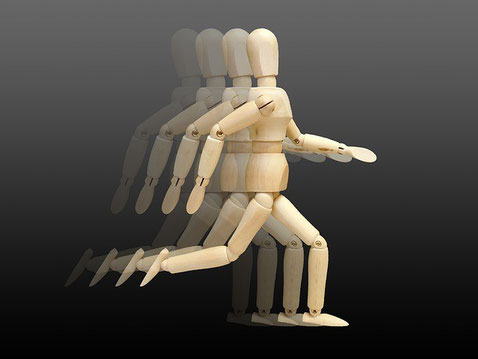
Ich bin keine Sportlerin, hab mich nie für sportlich gehalten, obwohl ich im Schulsport nicht zu den Bankhockerinnen gehörte und auch nicht zu denen, die als letztes in die Mannschaften gewählt wurden, was wohl mehr meiner mittleren Beliebtheit zu verdanken war, als meinem Ballgeschick. Aber ich wäre ein seltsames Kind gewesen, wenn ich mich nicht gerne auf natürliche Weise bewegt hätte, wenn ich nicht dann und wann einfach aus schierer Lebenslust gerannt wäre. Im Grund hielt ich mich sogar für eine schnelle Läuferin, einfach weil rennen so schön war. Auch wenn ich schon sehr bald auf dem Schuhof von denjenigen Mädchen überholt wurde, die lange Beine hatten, habe ich dadurch die Lust am schnellen Laufen nicht verloren. Und dazu bräuchte ich nicht mal einen besonderen Grund. Rennen macht einfach Spaß! Es fühlt sich großartig an, wenn man mal so richtig los düst, rausholt, was in einem steckt, so schnell es geht, wenn die Lunge durchgelumpt wird, einem der Wind in den Ohren pfeift und man beinahe abhebt.

Ich tat mich als Kind schwer mit dem Rollschuhlaufen, kletterte nie höher auf Bäume als bis zur untersten Astgabel, fuhr nur Schlittschuh, wenn es nicht zu vermeiden war und fürchtete mich beim Ballspiel davor, dran zu kommen. Aber ich liebte Federball. Federball mit Steffen. Und Gummitwist. Wenn die Spielpartnerinnen fehlten, spannte ich das Gummi um die metallenen Bäuche zweier Mülltonen. Sonst hielt ich nicht viel von Sport. Meine Mutter hatte zwischenzeitlich versucht, mir einen Turnverein im Ort schmackhaft zu machen. Nach der zweiten Probestunde beschloß ich, nie wieder dorthin zu gehen. Der Grund dafür war einfach. Dort waren Kinder, die ich nicht kannte und ich war davon überzeugt, dass ich sie auch niemals kennen lernen würde. So ist es dann auch gekommen. Das war meine Sportlerinnenkarriere. Kurz und erfolglos.
Dass ich jahrelang regelmäßig mit dem Fahrrad 15km zur Schule hin und auch wieder zurück fuhr oder aus purer Langeweile im Schwimmbad vierzig Fünfzigmeterbahnen abrockte, bis mir die Augen brannten, dass ich als Teenager Paris mehrfach zu Fuß durchquerte, weil ich kein Geld für eine Metrokarte hatte und man da unten ja nicht viel sieht, das alles hatte doch nichts mit Sport zu tun. Zu Fuß gehen war einfach die natürliche Art, sich fort zu bewegen. Warum auf einen Bus warten, wenn die Strecke auf den eigene Beinen schneller zurück gelegt war, als der Bus brauchte, um fauchend seine Türen zu öffnen, wieder zu schließen und sich schwankend in Bewegung zu setzen. Und dann diese Autos mit ihren weichen Sitzen, die so tief waren, dass man als Kind von der Außenwelt nichts mitbekam. Ein Auto ist für mich bis heute das Gegenteil von Freiheit. Aber rennen, das ist Freiheit, schnell wie ein wildes Tier, ungebremst wie der Wind, kraftvoll, wie ich immer gerne gewesen wäre. Rennen, das ist wie fliegen mit Bodenkontakt.
Als Kind rannte ich beispielsweise häufig zum Schulbus. Ich war nie spät dran. Dennoch rannte ich. Der Lederranzen auf meinem Rücken brachte mich bei jedem Schritt gehörig ins Schwanken, warf mich fast aus der Spur. Die losen Stifte im Ranzen, vergammelten Schulbrotreste, verwaisten Wachsmalblöckchen rappelten wild und vielstimmig darin herum und hinterließen rhythmische Gemälde auf den Heften. Trotz dieser erschwerten Bedingungen bin ich gerannt. Einfach so. Und heute mache ich das immer noch. Mal renne ich ein Stück zur Bahn, mal die Treppen hoch und je nach Schuhwerk auch schon mal hinunter, renne zum Briefkasten und wieder zurück und renne mehrfach zwischen halb sechs und halb sieben Uhr morgens zwischen unseren beiden Häusern hin und her, bis ich alles zusammen habe, was die Familie für den Start in den Tag braucht, vom Turnbeutel über die Margarine bis zum linken Fausthandschuh. Und wo ist überhaupt schon wieder mein Handykabel? Spätestens nach dem dritten Sprint bin ich hell wach.
Ich bin froh, dass ich so ein gutes Verhältnis zum Rennen habe. Ich musste noch nie um mein Leben rennen und kann mich nicht erinnern, dass ich vor etwas davonrennen musste. Aber Rennen als Sport? Das wäre mir früher nicht in den Sinn gekommen. Und in der Zeit, als das Wort Jogging aufkam, belächelte man als schöngeistigorientierter Mensch die bunten Freizeitsportler, die an roten Fußgängerampeln von einem Bein auf das andere hüpften, nur mitleidig.

Als ich jedoch mit Mitte Zwanzig von einem Tag auf den andern mit dem Rauchen aufhörte, wurde mir gewahr, wie viel Luft eine gesunde Lunge aufnehmen kann. Und als nach ein paar Tagen in meinem Körper, nach Ausbleiben des täglichen Nikotin-Dauerdämpfers, unbändige Kraft aufstieg, die nicht zu kanalisieren war, da musste ich es tun, um nicht zu platzen. Ich rannte. Weil ich keine passende Sportbekleidung besaß, bin ich in Sneakers und lockerer Hose die Treppen meiner Stadtwohnung runter gesprungen, in den Park gerannt und habe dort die ersten Joggingrunden meines Lebens gedreht. Mitten in der Innenstadt. Ich kam mir total dämlich vor, nicht nur, weil ich überhaupt joggte, wie die Leute, die ich sonst belächelt hatte, sondern auch, weil ich es mitten in der Stadt tat, nicht etwa in der schönen Natur. Später fand ich bessere Plätze zum Laufen, als der hundekotkontaminierten Grüngürtel. Und auch bessere Schuhe und eine bunte atmungsaktive Hose.
Wenn ich so darüber nachdenke, fällt mir auf, dass ich schon einmal zuvor gejoggt bin, bevor ich mit dem Rauchen angefangen hatte. Aber damals gab es das Wort noch nicht. Es musste in der sechsten oder siebten Klasse gewesen sein, als unser Sportlehrer einen Waldauf anordnete, hinter der Schule auf dem Damm zum Altrhein. Er hatte es verpasst, uns den Unterschied zwischen Dauerlauf, wie es damals noch hieß, und Wettrennen zu erklären und uns einfach los geschickt. So war ich zwar nach hundert Metern in der Spitzengruppe, nach zweihundert Metern aber auch am Ende meiner Kräfte, rätselnd, ob unser Lehrer es wirklich ernst gemeint haben konnte, als er etwas von fünf Kilometern gesagt hatte, und ich keuchte mir die Lunge aus dem Leib. Heute lache ich über fünf Kilometer und habe mein Verhältnis zum Sport korrigiert.

In der Familie, in der ich aufwuchs, herrschte die unumstößliche Meinung, Sportler sollten besser den Mund halten, als sich
öffenlich zu Wort melden, da sie allesamt unter sprachlichen und rethorischen Defiziten litten. Und dafür konnte man nicht nur Boris Becker verantwortlich machen. Es herrschte einmütige
Überheblichkeit über die lückenhafte Allgemeinbildung der Athleten im Allgemeinen und wenig Respekt für deren körperliche Leistungen. Auch im Allgemeinen. Sport als Freizeitgestaltung oder gar
als Lebensinhalt kam also nicht in Frage, wenn man sich nicht dem Gespött der Familie ausliefern wollte. Sport war was für die, die nichts anderes drauf hätten. Ich frage mich, wie meine Mutter,
die eine leidenschaftliche Schwimmerin ist, das aushalten konnte. So richtete ich mich erst als junge Erwachsene in meinem Körpereinsatz und verwendete ihn dafür, wofür er konstruiert ist: um
sich zu bewegen. Heute halte ich mich für eine nahsportilch veranlangte Person, verbringe Stunden meines Lebens am Rande von Fußballfeldern und auf den Bänken von fensterlosen Sporthallen, meine
Tochter ist die schnellste Läuferin ihrer Klasse, mein Sohn übt beharrlich an der Verbesserung seiner Korbleger und ich bin mit einem Schwimmer verheiratet. Und meistens sprechen wir sogar in
ganzen Sätzen.

Kommentar schreiben